Aşıklı Höyük in Mittelanatolien, 13.000 Jahre vor heute. Vor einigen Tagen hat eine Gruppe Kinder ein geschwächtes Schaf gefunden. Sie haben es mit nach Hause gebracht. In der Nacht hat es Lämmchen bekommen. Jetzt sitzen die Kinder bei dem müden Muttertier und halten die kleinen Lämmchen in den Armen. Als die Eltern kommen, um sich das Schauspiel anzusehen, sagt eines der Mädchen mit dem Lämmchen auf dem Arm „Es ist sooo niedlich! Können wir das behalten?“ Der Beginn einer Idee, die ganze Kulturen prägen wird:
Die Geschichte der Schafhaltung
Okay, zugegeben, die Kinder habe ich mir ausgedacht. Aber genau so könnte es sich zugetragen haben. Die DNA-Forschung konnte zeigen, die derzeit ersten bekannten Vorfahren unserer Hausschafe lebten in Aşıklı Höyük vor 10.000 Jahren mit Menschen des Neolithikums (Jungsteinzeit) zusammen.

Ja, das ist niedlich – sehr niedlich sogar (Bild: 4028mdk09 (CC BY-SA 3.0)).
In dieser Zeit gab es schon Siedlungen, aber noch keine Keramik. Von hier aus haben sich die Tiere verbreitet – zumindest ist es der älteste bekannte Fundplatz mit Schafknochen und die DNA-Analysen stimmen auch mit der Idee, dass hier die Schafzucht begann, überein. Es scheint sich zu zeigen: Es gab eine organisierte und strukturierte Schafzucht in dieser Lebenswelt.
Wie hat man das erforscht?
Der Fundplatz Aşıklı Höyük ist ein Glücksfall der Archäologie. Denn hier haben Menschen in ihrer Siedlung über einen Zeitraum von 1.000 Jahren Spuren hinterlassen. Zu diesem Spuren gehört auch der Abfall, also zum Beispiel auch Essensreste wie Schafknochen. Diese Knochen konnte man analysieren.
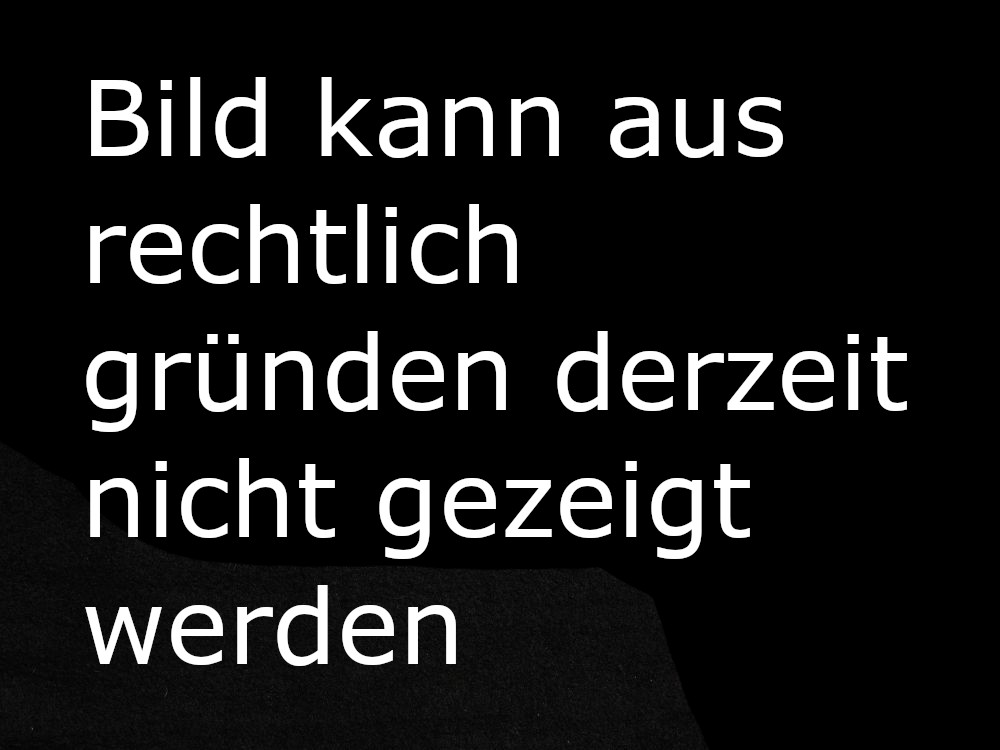
Aber die Analyse von einem Fundplatz alleine, ist noch kein Beleg dafür, dass hier der Ursprung der Schafhaltung liegt. Um diese Fragestellung zu erforschen wurden Schafknochen von unterschiedlichsten Fundplätzen in Europa und Asien untersucht – insgesamt 629 Tiere – und man konnte zeigen: Es gab bei den Schafen einen sog. Flaschenhalseffekt und das bedeutet, alle heute lebenden Schafe stammen von einer sehr kleinen Population ab.
Was ist der Flaschenhalseffekt?
Der Flaschenhals beschreibt eine verkleinernde Auswirkung auf die genetische Diversität einer Population. Oder anders gesagt: wegen einer unbekannten Ursache gab es mal viel vielfältigere Schafe, aber es haben sich nur einige wenige vermehrt. Die Individuen einer Spezies sind also genetisch einander sehr viel ähnlicher als gewöhnlich. Einen solchen Effekt hat es auch beim Homo Sapiens gegeben – Es bedeutet, dass es einen Einfluss gab, durch den nur eine kleine Gruppe die Vorfahren aller heute lebenden Individuen einer Art sind.
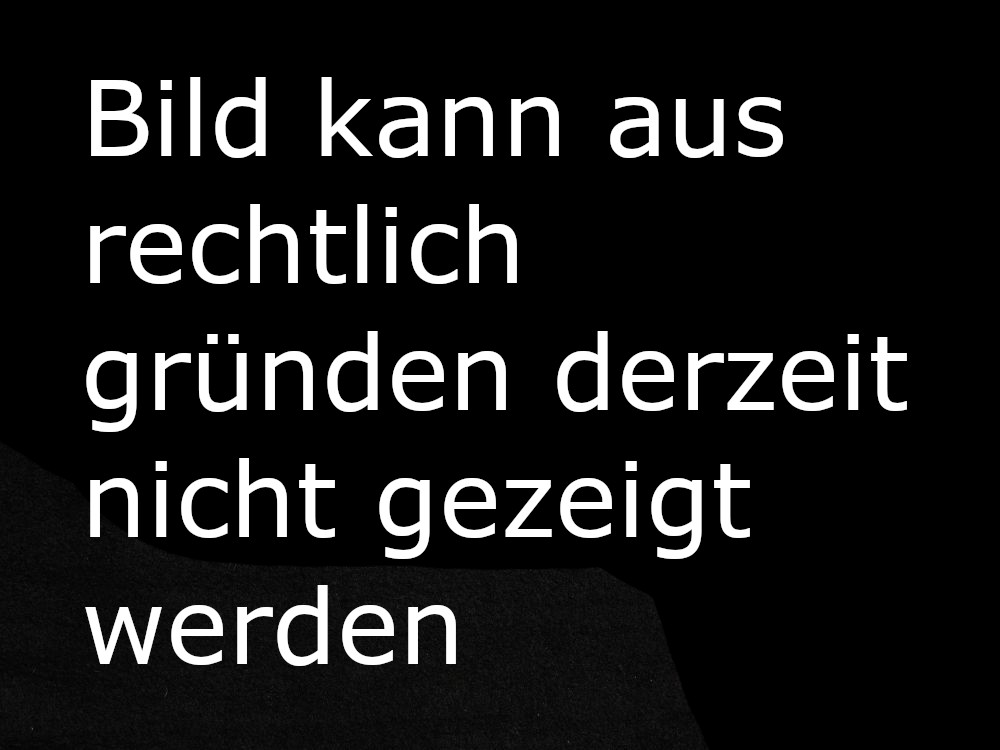
So ein Einfluss kann z.B. eine Naturkatastrophe sein, die nur wenige Exemplare dieser Art überlebt haben. Oder aber der Mensch ist selbst der Flaschenhals: Es ist gut möglich, dass durch Zuchtauswahl nur wenige Tiere dazu genutzt wurden, um die Population des Hausschafes zu vergrößern. Und das führt dazu, dass die genetische Vielfalt innerhalb der Hausschafe nicht so groß ist. Das kann eine Ursache für genetisch bedingte Erkrankungen sein, hat aber für ihr Erforschung einen Vorteil:
Man kann weit in den Stammbaum der Schafe zurückblicken
Es werden dazu Haplogruppen betrachtet. Das sind spezifische, signifikante Merkmale auf den Chromosomen. Diese Haplogruppen verglich man zwischen heute lebenden Schafe mit der DNA, die in Knochen von Schafen verschiedener archäologischer Fundplätze stammen. Das Ergebnis dieser Betrachtung ist: Es gibt nur zwei große DNA-Geschichten bei den Hausschafen. Die Haplogruppe A, die sich von Anatolien bis nach Ostasien verbreitet ha, und die Haplogruppe B, die vom gleichen Ursprung her in ganz Europa Verbreitung fand.
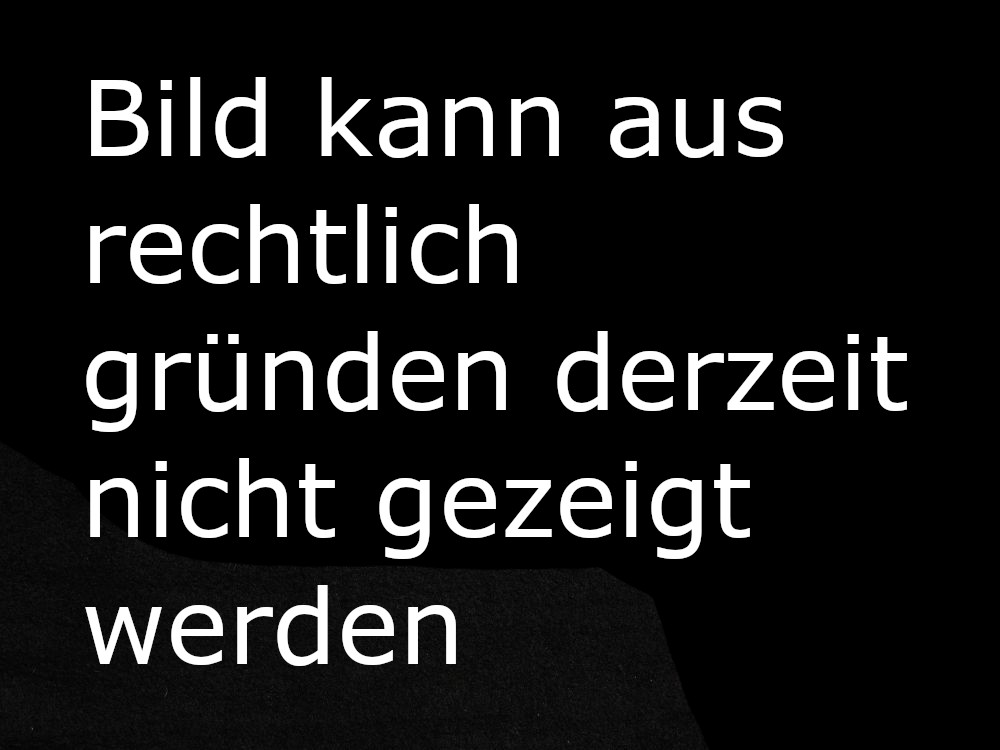
Die Analysen zeigen: am Anfang der Domestikation, also des Zusammenlebens von Schaf und Mensch, war diese genetische Vielfalt noch größer. Man kann 5 Haplogruppen nachweisen, betrachtet man die Mitochondriale DNA – also die genetische Vererbungslinie der weiblichen Tiere. Die heute verbreiteten Hausschafe gehen alle auf zwei Muttertiere zurück, die Gründerinnen der Haplogruppen A und B.
Und wie kamen die Menschen in Aşıklı Höyük jetzt wirklich auf die Idee Schafe zu halten?
Ganz klar ist das nicht. Aber es scheint so zu sein, dass Schafe zunächst gejagt wurden. Da kann man schnell auf die Idee kommen, dass es einfacher ist, diese Tiere gleich zu Hause aufzubewahren, oder wie man heute sagen würde: zu halten, dann erspart man sich die Strapazen einer Jagt. Aber: Man kann auch sehen, in Aşıklı Höyük gab es eine Zeit lang beides: Schafhaltung und die Jagt auf Wildschafe. Die Geschichte mit den Kindern, die die Lämmchen einfach niedlich finden, ist also gar nicht so weit hergeholt.
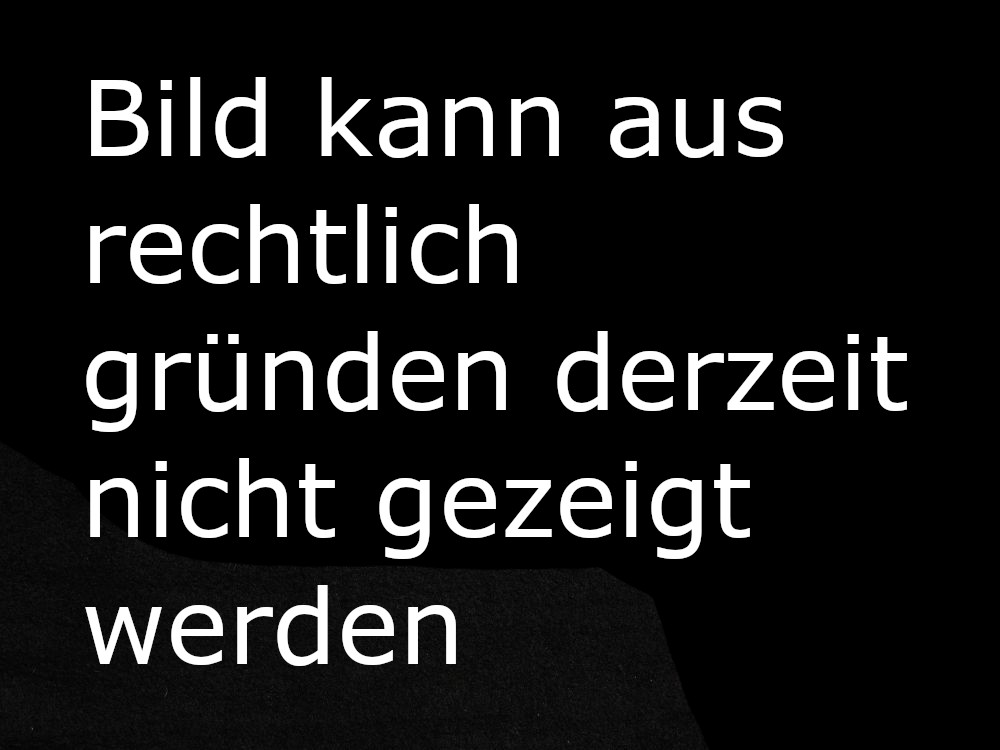
Die DNA Analysen zeigen: Es gab in Anatolien zunächst eine Zeit mit einer stabilen Schafpopulation, Tiere wurden zwischen den Dörfern getauscht und gelegentlich wurden Wildschafe mit Hausschafen gekreuzt. So sind wahrscheinlich auch die drei weiteren Haplogruppen entstanden, die man in der Frühzeit beobachten kann – die Haplogruppe E hatte von ihnen am längsten bestand, ist aber schließlich auch verschwunden. Die Verbreitung der Schafe findet erst später statt. Diese Urhausschafe hatten vmtl. kein so wolliges Fell wie heute, sodass die Wollnutzung wahrscheinlich erst später hinzukam.
Das Schaf war also ein reines Fleischtier?
Das sieht für die Anfangszeit tatsächlich so aus. Auch die Milch wurde nämlich vor 10.000 Jahren noch nicht genutzt – jedenfalls nach aktuellem Stand. Die derzeit älteste bekannte Nutzung von Milch ist 8.000 Jahre alt und findet sich im Kaukasus. Aber: Das wurde anhand von Zahnsteinanalysen erforscht und diese Forschung hat gerade erst begonnen. Man müsste also im Zahnstein der Menschen von Aşıklı Höyük nachsehen, ob sich dort Rückstände von Schafsmilch finden, um dies zu bestätigen.

Viele Käsesorten enthalten keine Laktose (Bild: Moritz Piyabaylizenz).
Bei der Erforschung des Zahnsteins hat sich gezeigt: Es gab erst den Konsum von Milchprodukten und dann die Laktosetoleranz. Man hat anscheinend schon relativ früh begonnen, Milch in Form von Käse haltbar zu machen, was sie auch für Menschen mit Laktoseintoleranz verdaulich macht. Ob man das in Aşıklı Höyük auch schon gemacht hat, wäre eine spannende Frage für weitere Forschungen.
Aber wie hat das Schaf denn jetzt ganze Kulturen geprägt?
Das Tier hat sich immer weiter verbreitet, und zwar im Zuge der Verbreitung der Landwirtschaft an sich. Und wie es scheint, war das nicht geplant, sondern nach und nach haben Menschen sich Hausschafe besorgt und sich eigene Herden aufgebaut. Die beiden Haplogruppen A und B sind durch diese Art der Verbreitung bis heute in unseren Hausschafen erhalten, sie haben sich durchgesetzt – vielleicht handelte es sich um zwei besonders umgängliche oder besonders wollige Tiere, die nach einigen Jahrhunderten der Domestikation in Anatolien entstanden sind. Die Nachfahren dieser beiden Tiere verbreiteten sich, die Population wurde größer, so entwickelten sich ganze Hirtenkulturen.

Je nachdem, mit welcher Tierart sich eine Kultur umgibt, ändert sich auch ihr Alltag. (Bild: Moreno Boeron Pixabaylizenz)
Bei der Jamnaja-Kultur zum Beispiel lässt sich zeigen, dass sie über einen Zeitraum von über 1.000 Jahren fast ausschließlich mit dem Schaf als Nutztier lebten. Diese Lebensweise als nomadische Schafhirten prägt natürlich das Alltagsleben der Menschen. Aber auch die Gesundheit. Denn wenn wir dicht mit Tieren zusammenleben, dann entstehen schneller Pandemien, wenn Viren zwischen Tier und Mensch hin und her springen. Krankheiten entstehen, die vorher unbekannt gewesen sind.
Wie Kleinigkeiten diese Welt beeinflussen
Abschließend kann man also sagen, es ist ein bisschen wie der Butterflyeffekt – vor 10.000 Jahren wurden das erste Mal Schäfchen gezählt. Die erste Entscheidung, Schafe bei sich aufzunehmen und mit ihnen zu leben, hat ein paar tausend Jahre später zu großen Populationen und ganzen Kulturen geführt, für die diese Lebensart ihr Hauptbrot war und ist. Und das ist nur eine der vielen Geschichten in der Archäologie, die so unscheinbar beginnen. Deswegen sind es die kleinen Dinge im Leben, die die Archäologie so akribisch betrachtet, denn sie haben manchmal die größten Auswirkungen.
Literatur:
https://www.archaeologie-online.de/nachrichten/erstmalige-einblicke-in-den-genetischen-flaschenhals-der-schafhaltung-in-der-jungsteinzeit-5881/
https://www.oeaw.ac.at/oeai/medien/newsarchiv/news-detail/von-der-steinzeit-bis-heute-genanalysen-offenbaren-dramatische-geschichte-domestizierter-schafe-1-1
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adj0954
